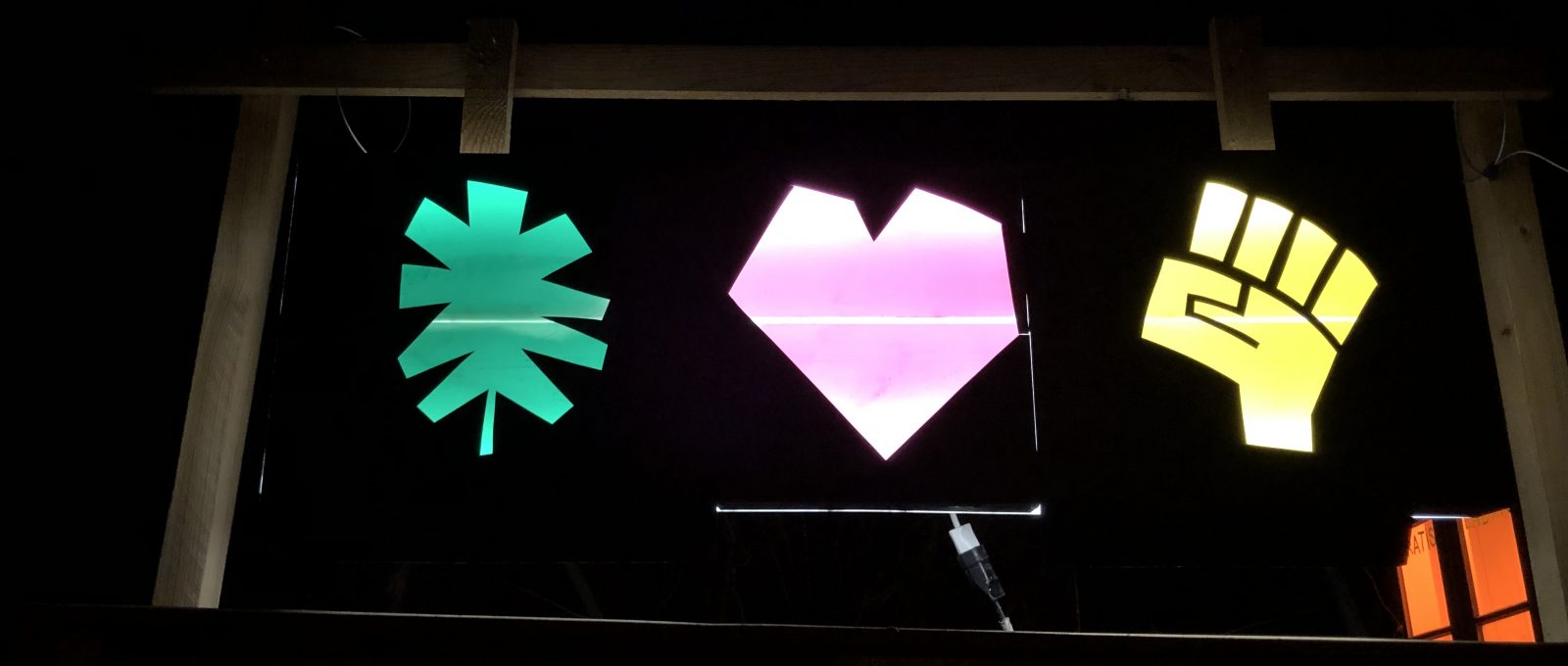Die zehnköpfige Wohngemeinschaft mit Kind hat eigentlich bis Ende Jahr einen Mietvertrag. Da die Stadt Luzern die jungen Untermieter*innen am Murmattenweg in die Hausbesetzer*innen-Ecke stellt, hat sie den Vertrag gekündigt und will die WG mit fadenscheiniger Begründung über Nacht auf die Strasse stellen. Ein Augenschein vor Ort.
Das ehemalige Soldatenhaus am Murmattweg 2 in Luzern gleicht von Weitem einem konventionellen Quartierzentrum. Durch die grossen, beleuchteten Fenster im Erdgeschoss sieht man Leute um einen langen Tisch sitzen. Ein paar Fahrzeuge stehen vor dem Haus, auf der kleinen Veranda rauchen ein paar Leute in dicke Decken eingemummt Zigaretten. Der grosse Gemeinschaftssaal ist erfüllt von gedämpftem Murmeln, ein Brief macht die Runde unter den Anwesenden: Die Stadt Luzern fordert die zehn Mieter*innen auf, das Haus bis morgen zu verlassen. «Absurd», schüttelt Andrea den Kopf, «aber willst du erst was essen? Wir haben den ganzen Nachmittag Ravioli gemacht». Andrea ist vielleicht dreissig Jahre alt, ein Mann mit ruhiger Stimme und wachen Augen. Dass sich eigentlich fremde Leute hier gemeinsam zusammensetzen und essen, sei Normalität geworden, erzählt Andrea während er einen Teller mit dampfender Pasta auf den Tisch stellt. An den wöchentlichen Mittagstisch kommen um die sechzig Menschen. Die Frau vom Kiosk gegenüber besorge sich immer eine Vertretung, damit sie hier essen kommen könne und die Angestellten der Stadtreinigung kommen meistens als ganze Gruppe. Auch an diesem Abend ist die Tischrunde bunt gemischt. Der Brief mit dem offiziellen Logo der Stadt Luzern wird mir in die Hand gedrückt. «Komm, lass uns oben quatschen», meint Andrea und öffnet die Türe neben der kleinen Bar, an der ein paar Leute anlehnen.
Kriminalisierung als Prävention
Der Holzboden ist uneben, an den einen Stellen senkt er sich um einige Zentimeter ab. Sonst aber erkenne ich wenig von den angeblichen Baumängeln. Die Wände sind mit weisser und hellblauer Farbe frisch gestrichen, die Fenster machen einen soliden Eindruck. Wir gehen ein enges Treppenhaus entlang, viele kleine Zimmer zweigen vom Gang ab. Simone kommt dazu, eine junge Frau mit langen Haaren und breitem Luzerner Dialekt. Wir setzen uns auf ein Sofa und ich lese den Brief:
«Ab sofort sind im gesamten Gebäudekomplex grössere Menschenansammlungen, insbesondere im Zusammenhang mit Veranstaltungen, zu vermeiden. Diese können Erschütterungen verursachen, die sich negativ auf die Stabilität auswirken. Durch eine Verkettung von ungünstigen Ereignissen wie zusätzlichem starkem Schneefall oder stürmischen Winden könnte die Gesamtstabilität beeinträchtigt und demzufolge auch Personen, die sich im Gebäude aufhalten, einem Risiko ausgesetzt werden»
What the fuck, wir werden gleich weggepustet?
Simone (lacht): Der Winter lässt ja bisher noch auf sich warten. Und was ist schon eine Veranstaltung? Sind wir vier, die hier sitzen und reden, schon eine Veranstaltung? Ich verstehe das nicht.
Wie kam es denn dazu, dass ihr dieses baufällige Haus bewohnt?
Simone: Das Haus weist tatsächlich einige Mängel auf. Aber da es nun mal vom Denkmalschutz als schützenswert eingestuft wurde und keine Abrissbewilligung vorliegt, muss die Stadt evaluieren, wie viel eine Instandhaltung oder allenfalls eine Sanierung kosten würde. Und dann müssen sie entscheiden, ob sich das «lohnt», diese Kosten zu tragen, oder nicht. Eingezogen sind wir als Untermieter*innen im Sommer 2018, damals waren wir neun Personen. Wir haben der Stadt eigentlich gleich angeboten, die nötigen Sanierungen selber zu finanzieren.
Andrea: Also eigentlich sind wir nicht offiziell Untermieter*innen, oder?
Eine junge Frau steckt den Kopf ins Zimmer. Sie heisst Oli.
Oli: Naja, aber ihr habt doch die Eigentümerin über das Untermietverhältnis informiert, oder? Und die haben euch dann auch als solche angesprochen? Das nennt man konkludente Zustimmung, wenn die von der Untermieter*innenschaft wissen und das dulden.
Oli setzt sich. Sie hat Jus studiert und besucht regelmässig die Veranstaltungen im Haus am Murmattweg. Mit ihrem Patenkind wollte sie kommenden Donnerstag eigentlich die Zaubershow sehen. Doch diese soll nie stattfinden, geht es nach dem Willen der Stadt. Was sagt Oli zur Einsturzgefahr?
Oli: Dieses Gutachten ist doch tendenziös. Was, wenn es die nächsten Tage gar nicht schneit oder windet? Wieso dürfen denn nur noch einzelne Menschen rein? Das riecht nach einem Gefälligkeitsgutachten. Ihr habt doch viele Veranstaltungen geplant diesen Monat oder? Vielleicht will die Stadt einfach nicht, dass da was läuft.
Andrea: Da steht, wir sollen unterschreiben, dass wir das Haus bis morgen verlassen werden. Und man habe dann den Tag durch Zeit, um «einige Gegenstände» zu entfernen. Aber man dürfe nicht mehr als zwei Personen sein. Das ist doch absurd!
Was will denn die Stadtverwaltung mit dieser Strategie erreichen?
Andrea: Wir haben den Verdacht, dass sie uns präventiv und pauschal kriminalisieren wollen. Wenn wir es nämlich jetzt nicht schaffen, rechtzeitig zu gehen, können sie uns mit der Polizei drohen. Dann sind wir die Kriminellen, wegen denen die Polizei kommen musste. Und wie Bitteschön soll ein ganzes Kulturzentrum mit zehn Bewohner*innen über Nacht das Haus verlassen?
Simone: Die von der Stadt haben sich zwar persönlich besorgt gezeigt, ob wir während der eigentlichen Dauer des Mietverhältnisses bis Ende Jahr irgendwo unterkommen würden, aber sie haben uns nie konkrete Alternativen geboten.

Der Eichenwald neben dem Haus zeichnet für den Namen des Projekts
Luzern hat ja auch eine sehr aktive Besetzer*innen-Kultur. Die Gundula 1 und 2, die Stella, die Rosa la Vache und die Pulp@…
Andrea: …ja, und immer wurden die Besetzungen gleich geräumt.
Oli: Ihr habt zwar einen Mietvertrag, aber weil euer Projekt ein selbstorganisierter Raum ist, stellt euch die Stadt in die selbe Ecke wie die Besetzungen. Und sie schicken sogar die gleichen Beamten, die sie sonst in die besetzten Häuser schicken.
Wieso ist die Stadt so repressiv?
Andrea: Das wüssten wir auch gerne. Interessant war ja auch der Fall der Besetzung der Villa der schwerreichen Bodum Invest AG im Jahr 2016, als 27 Personen mit Geldstrafen von bis zu 2000.- Fr. gedroht wurde. Und drei Journalisten, die über die Besetzung berichteten, bekamen ebenfalls eine Strafanzeige. Ich glaube Bodum hätte es am liebsten gehabt, wenn seine beiden Villen ganz aus den Medien verschwunden wären.
Beide Villen?
Andrea: Ja, Jørgen Bodum hat 2013 die zwei schützenswerten Villen an der Obergrundstrasse gekauft. Aber er liess die beiden Häuser verlottern. Beide Villen wurden übrigens mal besetzt.
Oli: Das kann natürlich auch eine Strategie sein. Wenn ein Gebäude als schützenswert eingeschätzt wird, dann gibt es natürlich strengere Auflagen. Dann gibt es aber auch gewisse Ausnahmen, die in etwa sagen, dass ein Abriss nur zulässig ist, wenn eine Sanierung aus statischen Gründen nicht möglich oder aus wirtschaftlichen Gründen unverhältnismässig wäre. Wenn man Häuser willentlich verlottern lässt, kann man so einen profitablen Neubau möglich machen.
Simone: Aber die Besetzungen haben schon auch etwas bewirkt. Die Stadträtin Manuela Jost beispielsweise musste öffentlich zugeben, dass Bodum bereits vor der Besetzung eine Abrissbewilligung in Aussicht gestellt wurde. Und es gab strengere Auflagen gegen Bodum, dass die jetzt neu ein «bewilligungsfähiges und qualitativ hochstehendes Bauprojekt» vorweisen müssen, wenn sie abreissen wollen.
Andrea: Ja, aber geändert hat sich nicht viel. Beide Häuser sind nach wie vor leer. Und auch hier: Wo bis jetzt zehn Menschen wohnen, soll höchstens noch ein Materiallager hin.
Faber und Whirlpool
Aus dem Nebenzimmer ertönt ein Kinderschreien. Andrea steht auf und kommt mit dem drei Monate alten Baby im Arm zurück. Er wiegt es hin und her. «Lass uns eine Runde durchs Haus machen», meint er. In Gemeinschaftsraum spielt unterdessen ein junger Mann Gitarre, einige Scheinwerfer und ein Vorhang trennen eine Bühne vom Rest des Raumes ab. «Hier hat letzte Woche Faber gespielt», meint Andrea. «Da waren vielleicht so zweihundert Leute. Vielleicht sind es diese Veranstaltungen, die die Stadt meint. Aber wie du siehst, das Haus steht noch». Im Garten ein grosser Bauwagen, den Eingang zu einer Werkstatt und ein kleiner Pool, der mit einer grossen, hellblauen Plastikblache abgedeckt ist. Ein kleiner Holzofen ist an den Pool angeschlossen und heizt das Wasser bei Bedarf auf.
Kollektive Entscheidungsprozesse – der Albtraum der Stadt
Zurück im Gemeinschaftsraum. Eine junge Frau kommt mit einem Laptop in der Hand die Treppe runter. «Wir müssen denen von der Stadt ja irgendwas antworten!?», sagt sie und verschwindet mit einem Grüppchen in der Küche. «Es sind nicht mal alle Mieter*innen hier», meint Andreas und schüttelt den Kopf. «Das ist auch witzig, das kannst du schreiben. Die von der Stadt hassen kollektive Entscheidungsprozesse. Das haben sie bei unseren Bemühungen, mit ihnen an einen Tisch zu sitzen und geregelte Mietkonditionen zu diskutieren, immer durchblicken lassen. Keine Hierarchien, keine delegierten Verantwortlichkeiten. Das ist natürlich anstrengender für sie, weil sich die Leute wirklich mit den Themen auseinandersetzen und das macht es für sie kompliziert. Gleichzeitig verlangen sie, dass alle zehn Mieter*innen über Nacht das Papier unterschreiben, das Haus verlassen und sich mitten im Dezember irgendwie neu organisieren». Wir gehen durch das Treppenhaus zurück, vorbei an einem riesigen Plakat, auf dem das Monatsprogramm aufgelistet ist. Morgen sollte es Yoga geben, am Wochenende ein Theater für Kinder ab zwei Jahren. Immer donnerstags Mittagstisch und ein Liedermacherkonzert am Freitag. Andrea ereifert sich: «Über die letzten Wochen hinweg kamen fast täglich Beamte, Ingenieure und Handwerker, um das ganze Haus bezüglich Bausubstanz und Statik zu untersuchen. Aber stell dir vor, die haben dann tatsächlich auch alle Steckdosen überprüft. Laut denen soll ab morgen gar niemand mehr hier wohnen, weshalb müssen die dann jede einzelne Steckdose prüfen? Da ist doch was faul!»

Das Programm im Eichwäldli
Habt ihr extra ein Kinderprogramm zusammengestellt, um euch beliebt zu machen?
Simone: Ja klar… Nein Blödsinn. Wir sind nunmal zum Quartiertreff geworden. Es gibt zum Beispiel auch einen kleinen Gratisladen. Die Kids aus der Umgebung stehen da total drauf. Schliesslich ist ja das Tolle an diesem Raum, dass wir ihn so gestalten können, wie wir wollen. Und wir wollen nun mal in einer offenen Nachbarschaft leben.
Die junge Frau mit dem Computer kommt zurück. «Wir haben eine Architektin gefunden. Die wird ein unabhängiges Gutachten erstellen. Das können wir jetzt denen von der Stadt schreiben», meint sie und setzt sich in eine Ecke des Zimmers, um den Brief fertig zu schreiben. Das Kind von Andrea ist mittlerweile eingeschlafen. Er geht nach draussen auf die Veranda und lehnt sich ans Geländer. Es ist kalt, sein Atem hinterlässt kleine Wölkchen in der Luft. «Wenn die unser Wohnprojekt beenden, zerstören sie meine ganze momentane Lebensgrundlage. Der Ort, wo ich wohne, arbeite, lebe, wo mein Kind geboren wurde. Da versuchen Behörden ständig Quartiere zu beleben und zu durchmischen. Sie schreiben irgendwelche Konzepte und handeln Stellenprozente für soziokulturelle Animation aus. Das ist doch alles eine Farce. Und wenn es einfach so passiert, wie hier, dann müssen sie es kaputt machen. Aus Prinzip.»