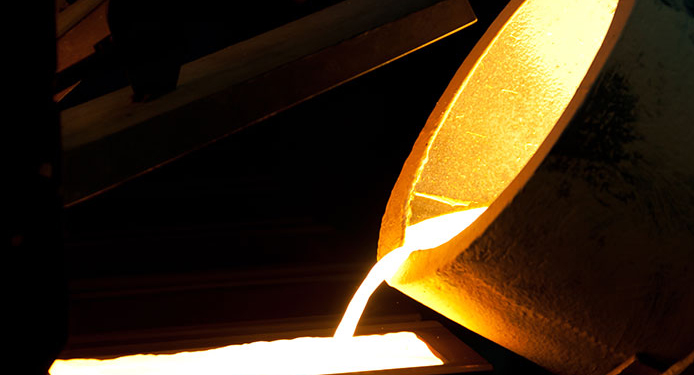Der Kapitalismus produziert CO2, Klimagipfel heisse Luft. Dagegen brauchen wir keine Diskussionen um die richtige Taktik, sondern radikale Kritik und Praxis.
Seit Sonntag läuft in Glasgow (Schottland) die 26. UNO-Klimakonferenz (COP26). Die Staatenlenker:innen schauen ernst in die Kameras. Rund um den Globus gehen Menschen auf die Strasse, um sie an ihre Versprechen zu erinnern. In den Medien erscheinen Beiträge voller «hätte, sollte, müsste». Herauskommen wird dabei nichts als heisse Luft.
«Hätte, sollte, müsste» prägt auch die hiesige Klimabewegung. Nachdem sie im Frühling 2020 durch den Pandemie-Shutdown von der Strasse verbannt wurde, hat sie Mühe, wieder an die Grösse und Breite der vergangenen Mobilisierungen anzuknüpfen. Die mediale Kritik hat indes deutlich zugenommen: Der Klimastreik sei zu radikal geworden und konzentriere sich lieber auf Klassenkampf und Feminismus statt auf die Klimakrise.

Die Krise verstehen und verhindern
Dass sich Kapitalismuskritik innerhalb der Klimabewegung herumspricht, ist nur konsequent. Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoss ist ebenso offensichtlich, wie das Interesse der Konzerne und ihrer Lobbyist:innen, griffige Massnahmen gegen die Klimakrise zu sabotieren. Es ist daher zentral, dass die Bewegung die Klimakrise als gesellschaftliche Krise begreift.
Es ist zentral, dass die Bewegung die Klimakrise als gesellschaftliche Krise begreift.
Klimaforscher:innen können Prognosen darüber abgeben, wie sich das Schmelzen der Polkappen auf den Meeresspiegel auswirkt und wie sich die Niederschlagsmengen in den kommenden Jahrzehnten verändern werden. Welche Folgen das für die Menschen hat und wer davon am stärksten betroffen sein wird, können sie aber nicht erklären. Um das zu verstehen und vor allem zu verhindern, ist eine Analyse der Gesellschaft notwendig. Dass Themen wie Feminismus, Antirassismus und Ausbeutung innerhalb der Klimabewegung wichtiger werden, ist vor diesem Hintergrund also genau richtig.
CAP: Plan für Klimagerechtigkeit
Diese gesamtgesellschaftliche Perspektive zeigt sich auch im «Climate Action Plan (CAP)», den der Klimastreik Schweiz im Januar dieses Jahres vorgestellt hat. Auf über dreihundert Seiten listen die Autor:innen 138 Massnahmen auf, mit denen das Ziel des Pariser Klimaabkommens erreicht werden könnte, den Netto-CO2-Ausstoss der Schweiz bis 2030 auf null zu senken. Dabei finden sich klassische Klimaschutzmassnahmen wie das Verbot von Verbrennungsmotoren oder Ölheizungen. Der Plan geht aber weit darüber hinaus und umfasst auch Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung, weitgehender Abschaffung des Privateigentums oder Ausweitung der demokratischen Rechte auf alle Bewohner:innen des Landes.
Die Autor:innen übernehmen mit der Ausarbeitung dieses Aktionsplans gewissermassen die Arbeit des Schweizer Staates. Dieser müsste sich eigentlich überlegen, wie das Land die völkerrechtlich verbindlichen Ziele des Pariser Klimaabkommens erfüllen kann. Entsprechend technokratisch kommt das Papier auch daher. Die Autor:innen beziehen sich strikt auf wissenschaftliche Erkenntnisse, argumentieren unpolitisch und vermeiden jeden Anschein von radikaler Kritik. Trotzdem – oder gerade deswegen – wird darin der umfassende Charakter der Klimakrise deutlich. Man kann nur zum Schluss kommen: Es braucht eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung.

Antworten suchen in der Praxis
Was man im Plan allerdings vergeblich sucht, sind Überlegungen dazu, wie die vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt werden können. Womit sollen wir anfangen? Welche gesellschaftlichen Kräfte müssen gestärkt werden? Wer wird gegen den Klimaschutz Widerstand leisten und wie kann man diesen brechen? Und wie kann die Klimabewegung den Staat überhaupt dazu bringen, die Massnahmen umzusetzen?
Antworten auf diese Fragen wären im CAP vermutlich auch nicht am richtigen Ort. Die Schweizer Klimabewegung sucht sie in der Praxis. Im Rahmen des Strike for Future im Mai dieses Jahres übte sie den Schulterschluss mit Gewerkschaften, sozialen Bewegungen und zivilgesellschaftlichen Akteur:innen. Das Thema Klimakrise wurde offensiv in die Gewerkschaften hineingetragen, die Kämpfe der feministischen und antirassistischen Bewegungen mit der Klimabewegung verknüpft. Gleichzeitig wurde die Gründung von Klimaversammlungen in Quartieren und von Basisgruppen in Betrieben angeregt.
Wirkungslose Blockaden
Im Sommer mobilisierte Rise Up for Change nach Zürich zu «Aktionen des zivilen Ungehorsams» gegen den Finanzplatz. Im Herbst 2020 löste die Besetzung des Bundesplatzes in Bern noch eine kleine Staatskrise aus. Dieses Mal waren die Sitzblockaden vor den Eingängen von CS und UBS am Paradeplatz schnell aufgelöst. Das erhoffte mediale Echo blieb weitgehend aus.

Noch unspektakulärer scheiterte die Gruppe Extinction Rebellion vor einigen Wochen. Ihre gross angekündigte Aktion, frei nach dem Motto «Zürich blockieren bis endlich etwas passiert» bestand aus einer eher bescheidenen Menschenansammlung, die vor allem den öffentlichen Verkehr in der Zürcher Bahnhofstrasse für einige Stunden lahmlegte. Sollte der Bundesrat von der Aktion überhaupt mitbekommen haben, so zeigte er sich davon gänzlich unbeeindruckt.
Ziviler Ungehorsam als Lobbying
Auch wenn diverse NZZ-Leitartikel einen anderen Eindruck erwecken: Diese Art der politischen Praxis wird den Staat nicht aus den Angeln heben. Das liegt weniger an der unerhörten Höflichkeit, mit denen die Aktivist:innen jeweils auftreten, sondern vielmehr an der Strategie, die diesen Aktionen zugrunde liegt.
Bei Lichte betrachtet betreibt die Klimabewegung primär militantes Lobbying für den Klimaschutz. Man appelliert an Staat und Konzerne, doch bitte endlich etwas zu unternehmen. «Radikalisierung» bedeutet in dem Fall, dass man die Forderungen etwas nachdrücklicher und lauter wiederholt. Wie das eben so üblich ist, wenn das Gegenüber nicht zuhören will. An guten Argumenten mangelt es dabei nicht: Die Aktionen werden oft flankiert von ausführlichen Berichten, Studien und Dokumentationen, die meist besser informiert sind, als das Bundesamt für Umwelt und die Nachhaltigkeitsabteilungen der Grossbanken.
Besser Pipelines in die Luft jagen?
Andreas Malm, einer der prominentesten Theoretiker der Klimabewegung treibt die Strategie des militanten Lobbyings auf die Spitze. Sein vieldiskutiertes Buch «How to Blow Up a Pipeline» bietet keine Anleitung zur Sabotage, sondern ist eine Aufforderung zuhanden der Klimabewegung, so viel Sachschaden wie möglich zu verursachen. Die Palette der Aktionsformen reicht bei Malm vom nächtlichen Entlüften von SUV-Reifen über das Blockieren von Kohlegruben (wie bei Ende Gelände) bis hin zu eben jenem «in die Luft Jagen».
Andreas Malm fordert die Klimabewegung dazu auf, so viel Sachschaden wie möglich zu verursachen. Der Preis fürs Nichthandeln, soll hochgetrieben werden.
Auch diese Aktionen richten sich nicht gegen den Staat, sondern fordern ihn zum Handeln auf. Der Preis fürs Nichthandeln soll hochgetrieben werden, so dass es für den Staat irgendwann günstiger ist, das (fossile) Kapital an die Leine zu nehmen und den CO2-Ausstoss zu bremsen.
Strategischer Pazifismus ist ein Fehler
Das Ansinnen von Andreas Malm ist angesichts der fast schon naiven Bravheit der internationalen Klimabewegung total nachvollziehbar. Nicht erst seit der Mobilisierungswelle ab 2018 ist in der Bewegung (zumindest im globalen Norden) das Konzept des «strategischen Pazifismus» hegemonial. Alle Aktionsformen die als «Gewalt» ausgelegt werden können werden vermieden – was in der Regel jede Form von Sachschaden miteinschliesst.
Dieses Konzept folgt dem Mythos, wonach soziale Bewegungen erfolgreicher sind, wenn sie «gewaltfrei» agieren, weil sie dann angeblich mehr Sympathien in der Bevölkerung und der Politik geniessen und ihre Forderungen eher aufgenommen werden. Malm prüft das an vielen historischen Beispielen. Und egal wie man zur Gewaltfrage steht, muss man zum Schluss kommen: Es stimmt einfach nicht.
BLM: Militanz als Katalysator
Dies zeigte sich etwa eindrücklich bei den Black Lives Matter-Protesten im Sommer 2020. Nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch die Polizei in Minneapolis (USA) brannten wütende Demonstrant:innen die Polizeistation nieder, in welcher der Mörder arbeitete. Dieses Ereignis wirkte als Katalysator, im ganzen Land gingen Menschen auf die Strasse um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Die Bilder der brennenden Polizeistation in Minneapolis wurden zum Symbol und zeigten der Welt: Die Polizei ist angreifbar, es ist möglich sie für ihre rassistische Gewalt zur Rechenschaft zu ziehen.
Oft blieben die Black Lives Matter-Proteste «friedlich», vielerorts kam es aber auch zu Angriffen auf die Polizei und zu Plünderungen. Ihrer Popularität tat dies keinen Abbruch: Rund um den Globus solidarisierten sich Menschen mit Black Lives Matter, auch in der Schweiz gingen Zehntausende auf die Strasse. Bei der Männerfussball-Europameisterschaft diesen Sommer knieten sich viele Spieler hin, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Keiner der Spieler verlor indes auch nur ein Wort über den Rassismus in Europa und an seinen Aussengrenzen. Die Brandruine in Minneapolis macht den entscheidenden Unterschied.

Sinnlose Taktikdiskussionen
Die BLM-Bewegung – und alle anderen der zahlreichen Protestbewegungen und Aufstände der letzten Jahre – zeigen aber auch: Diskussionen um die richtige Taktik sind sinnlos. Wenn’s knallt, dann knallt’s. Menschen finden verschiedene Mittel und Wege, für ihre Anliegen zu demonstrieren und lassen sich weder von rechten Cops noch von linken Peacemakern dreinreden.
Andreas Malm hängt keinem Gewaltfetisch an, er plädiert für eine Vielfalt der Aktionsformen. Er fordert die Klimabewegung auf, sich die Frage zu stellen: Wie können wir die Verursacher der Klimakatastrophen zur Rechenschaft ziehen? Wie können wir sie zwingen, mit ihrem mörderischen Treiben aufzuhören?
Staat oder Revolution?
Trotzdem denkt auch Malm nicht über den Staat hinaus. Im Gegenteil: Nur dieser – so Malm – hätte die Machtmittel um die nötigen Massnahmen zu ergreifen, in der kurzen Zeit, die uns noch bleibt. Malms Vorbild für Massnahmen gegen die Klimakrise ist der Kriegskommunismus. Also die Politik der jungen Sowjetunion, die unmittelbar nach der Revolution 1917 den Zarismus besiegen, den Ersten Weltkrieg beenden und das soziale Elend im Land lindern musste. Dazu sei es für Lenin und die Bolschewiki notwendig gewesen, den Staat eben nicht zu zerschlagen, sondern die Kontrolle über diese «Formation bewaffneter Männer» zu übernehmen, um Mittel gegen die Krise in der Hand zu haben. Folglich fordert Malm auch einen «Ökoleninismus», um die Klimakrise zu stoppen.
Was unter «Leninismus» firmiert, sind vor allem taktischen Überlegungen Lenins in Bezug auf die russische Revolution, die später zur Ideologie geronnen sind. Dabei steht die Frage nach dem Umgang mit der politischen Macht im Zentrum. Genau diese Frage stellt sich Malm aber nicht: Wie sollten sich die Klimaaktivist:innen organisieren, um den Staat zu übernehmen? Mit welchen Mitteln wollen sie das bewerkstelligen? Sie wären aber entscheidend, wenn der «Ökoleninismus» nicht ein gut klingendes, aber leeres Schlagwort bleiben soll. Malms Argumentation läuft auf die Erwartung hinaus, dass es der bürgerliche Staat ist, der unter genügend hohem Druck dann schon im Sinne der Klimabewegung agieren wird, um endlich Ruhe im Karton zu haben.
Kapitalismus hängt an fossilen Energien
Dass die Staatengemeinschaft oder einzelne Staaten die notwendigen Massnahmen umsetzen werden, ist illusorisch. Die gesamte Weltwirtschaft hängt am Tropf von Öl, Kohle und Gas. Ein Ausstieg aus den fossilen Energien würde ganze Branchen ruinieren und allen anderen Branchen immense Umstellungskosten aufzwingen. Kein Staat kann das finanzieren, schon gar nicht in krisenhaften Zeiten wie diesen. Zudem stehen die nationalen Ökonomien in Konkurrenz zu einander, was dazu führt, dass alle warten, bis andere etwas machen. Und es gibt viele Staaten, die sich fast ausschliesslich über fossile Energien finanzieren.
Konkurrenz, Profit und Wachstum sind keine Naturgesetze. Ihre Abschaffung ist durch eine umfassende Umwälzung der Gesellschaft möglich.
Es ist also zumindest zweifelhaft, dass der Druck einer Bewegung auf die Staaten jemals gross genug sein kann, um den Druck der wirtschaftlichen Interessen und Zwänge auszuhebeln. Aber die Zwänge von Konkurrenz, Profit und Wachstum sind keine Naturgesetze. Ihre Abschaffung ist durch eine umfassende Umwälzung der Gesellschaft möglich: Die Überwindung des Kapitalismus. Das beinhaltet aber, dass die bürgerlichen Nationalstaaten abgeschafft und durch eine neue Form des Gemeinwesens ersetzt werden.
Den Horizont nicht verengen lassen
Die Überwindung des Kapitalismus ist zwar nötig, aber steht zugegebenermassen nicht vor der Tür. Die Klimabewegung übt sich deshalb gezwungenermassen in Pragmatismus. Es ist richtig, der Realität ins Auge zu blicken und auch für kleine Verbesserungen zu kämpfen. Doch man darf sich den Horizont dadurch nicht verengen lassen. Wenn man sich zu sehr in realpolitischen Diskussionen verliert, wird der Pragmatismus kontraproduktiv.
So hat schon die vergleichsweise simple Frage, ob das CO2-Gesetz nun zu unterstützen sei oder nicht, in der hiesigen Klimabewegung hitzige Diskussionen ausgelöst. Alle waren sich einig, dass die darin beschlossenen Massnahmen nicht ausreichen werden, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Uneinig war man sich aber, ob es nun als «kleiner Schritt in die richtige Richtung» zu unterstützen sei oder ob man es ablehnen müsse, weil es vor allem den Konsum verteuert und den Finanzplatz als grössten CO2-Treiber nicht behelligt. Schliesslich wurde das Gesetz insbesondere durch Stimmen von Rechts in einem Referendum versenkt, was die Krise der Bewegung weiter verschärfte.
Radikale Kritik, Solidarität und Inspiration
Auch der Klimagipfel in Glasgow zeigt: Der Klimabewegung fehlt es an Stärke, um wirksam auf das politische Geschehen Einfluss zu nehmen. Diese Tatsache zu ignorieren hilft auch nicht weiter. Ebenso wenig lässt sich dieser Schwäche mit besserer Organisierung oder taktischen Raffinessen beikommen. Breite und Einfluss von Bewegungen sind eine Frage von gesellschaftlicher Dynamik und nicht von Strategie und Taktik. In diese Dynamik kann man natürlich intervenieren, aber nur sehr begrenzt.
Die Klimabewegung braucht Vorstellungen einer ökologischen und solidarischen Gesellschaft, keine Vorschläge für Massnahmenpakete, die sowieso niemand umsetzt.
Verzweiflung ist fehl am Platz. Vielversprechender ist es, sich selbst aus der realpolitischen Verantwortung zu entlassen. Die Klimabewegung braucht Vorstellungen einer ökologischen und solidarischen Gesellschaft, keine Vorschläge für Massnahmenpakete, die sowieso niemand umsetzt. Das hiesse eine radikale Kritik zu formulieren, die die Klimakrise als gesellschaftliches Problem erfasst und Pläne skizziert, die die Bedürfnisse der Menschen ins Zentrum stellt.
Das lässt sich auch auf die Praxis anwenden: Ob wir eine Bank blockieren, massenhaft SUVs zerkratzen, vor dem Parlament demonstrieren oder Pipelines sprengen, ist erstmal nicht so wichtig. Aber eine Vielfalt von Aktionsformen, die für sich nicht den Anspruch erheben, den direkten Weg zum Ziel vorzugeben, kann vielleicht eine Dynamik erzeugen, die die Verhältnisse wirklich ins Wanken bringt.
Die Klimabewegung ist dabei nicht allein: Wie eingangs erwähnt, sucht sie den Schulterschluss mit feministischen, antirassistischen, gewerkschaftlichen und anderen sozialen Bewegungen. Sie alle eint das Ziel einer umfassenden gesellschaftlichen Umwälzung. Darum ist es nur richtig, dass sich die Akteur:innen sowohl in der Kritik als auch in der Praxis aufeinander beziehen und voneinander lernen.
Am 6. November finden in Zürich und Lausanne Demonstrationen zur COP26 statt, am 7. November zudem ein ökosozialistisches Forum im Kanzlei Club Zürich.
Andreas Malm: Wie man eine Pipeline in die Luft jagt. Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen, Matthes & Seitz Berlin, 2020

Titelbild von Markus Spiske/Unsplash